Verbleib von Spike-Proteinen im Gehirn könnten Long COVID-Symptome erklären
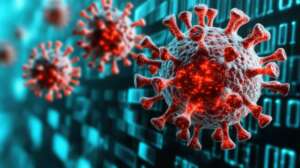
In der Studie von Helmholtz Munich und der Ludwig-Maximilians-Universität München konnte nachgewiesen werden, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein in den schützenden Schichten des Gehirns, den Hirnhäuten und im Knochenmark des Schädels, bis zu vier Jahre nach der Infektion verbleiben kann. Dies könnte zu chronischen Entzündungen führen und das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer- oder Parkinson-Krankheit erhöhen. Versuche mit Mäusen zeigten zudem, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe die Anreicherung des Spike-Proteins im Gehirn deutlich reduzieren.
Die Forschende konnten anhand einer neuartigen KI-gestützte Bildgebungstechnik herausfinden, wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein das Gehirn beeinflusst. Dabei entdeckten sie eine bisher nicht festgestellte Ablagerung des Spike-Proteins in Gewebeproben (postmortem) von Menschen mit COVID-19 sowie Mäusen. Ali Ertürk, Direktor des Instituts für Intelligente Biotechnologien bei Helmholtz Munich, sagte dazu: „Unsere Daten deuten auch darauf hin, dass das persistierende Spike-Protein an den Grenzen des Gehirns zu den langfristigen neurologischen Effekten von COVID-19 und Long COVID beitragen könnte. Dazu gehört auch eine beschleunigte Gehirnalterung, die für Betroffene den Verlust von fünf bis zehn Jahren gesunder Gehirnfunktion bedeuten könnte.“
Darüber hinaus stellten die Forschenden an geimpften Mäusen fest, dass der mRNA-COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer die Anreicherung des Spike-Proteins im Gehirn um 50 Prozent reduziert. Andere mRNA-Impfstoffe oder Impfstofftypen wurden nicht untersucht. Ertürk schlussfolgerte: „Unsere Studie zeigt, dass mRNA-Impfstoffe das Risiko langfristiger neurologischer Folgen erheblich senken können und somit einen entscheidenden Schutz bieten. Aber auch nach Impfungen kommt es zu Infektionen, die zu persistierenden Spike-Proteinen im Körper führen können. Die Folge können chronische Gehirnentzündungen und ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und andere Hirnschäden sein – die dann erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Gesundheitssysteme weltweit haben.“
Wenn sich Spike-Proteine oder Entzündungsmarker mittels Tests im Blut oder der Gehirnflüssigkeit identifizieren ließen, könnte dies neue Möglichkeiten zur Diagnose und Behandlung langfristiger neurologischer Effekte von COVID-19 eröffnen. Solche Marker seien für eine frühzeitige Diagnose von COVID-19-bedingten neurologischen Komplikationen wichtig. „Darüber hinaus“, so Ertürk „könnte die Charakterisierung dieser Proteine die Entwicklung gezielter Therapien und Biomarker unterstützen, um neurologische Beeinträchtigungen durch COVID-19 besser zu behandeln oder sogar zu verhindern.“
Zur Studie: https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(24)00438-4
Diesen Beitrag teilen:
Über Telegram teilen
Auf X (Twitter) teilen
Auf WhatsApp teilen
Auf LinkedIn teilen
Per E-Mail teilen
Vielleicht interessiert Sie auch
Details zur Qualitätssicherung der gesundheitsbezogenen Inhalte lesen Sie bitte in unserem Methodenpapier.



