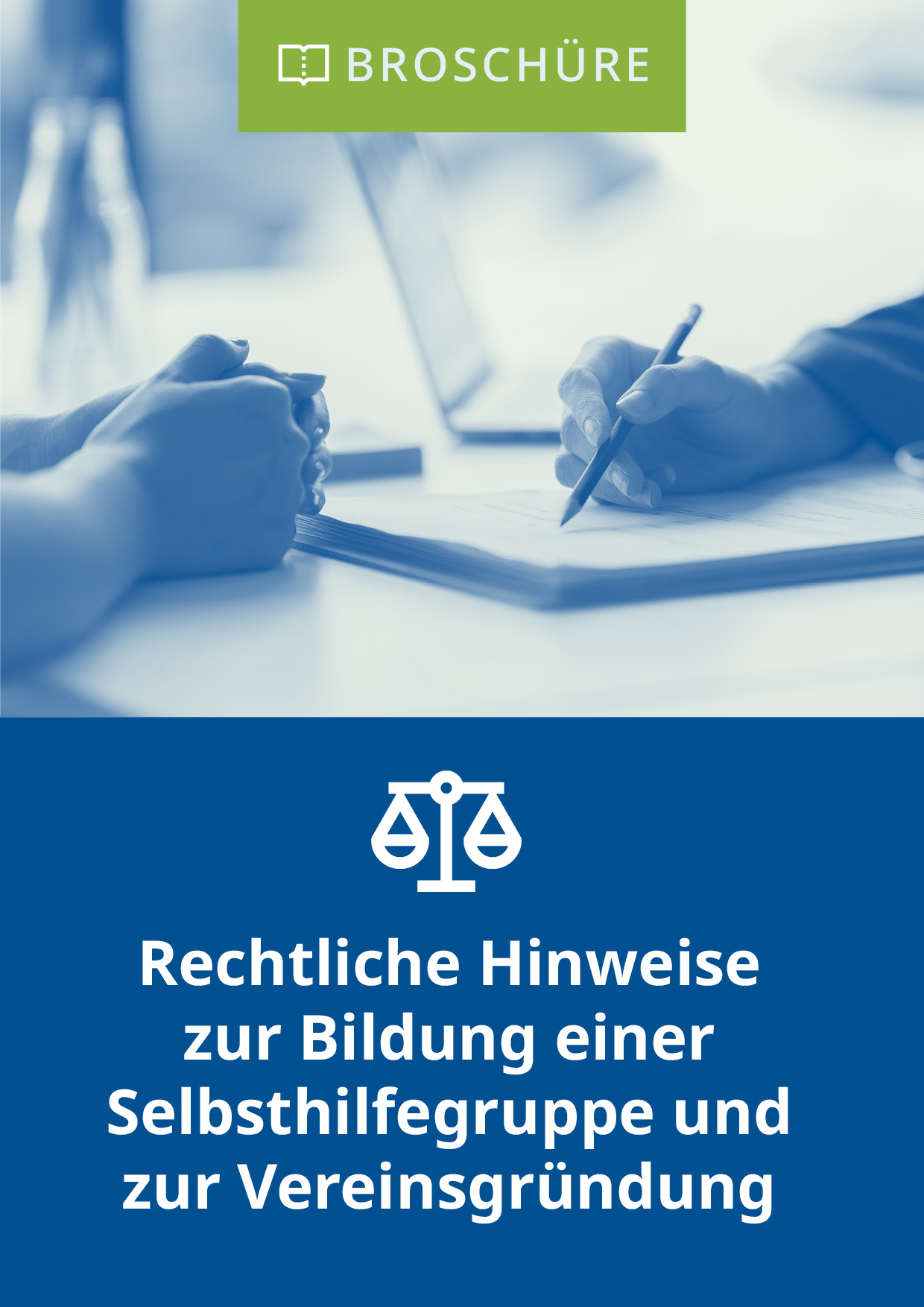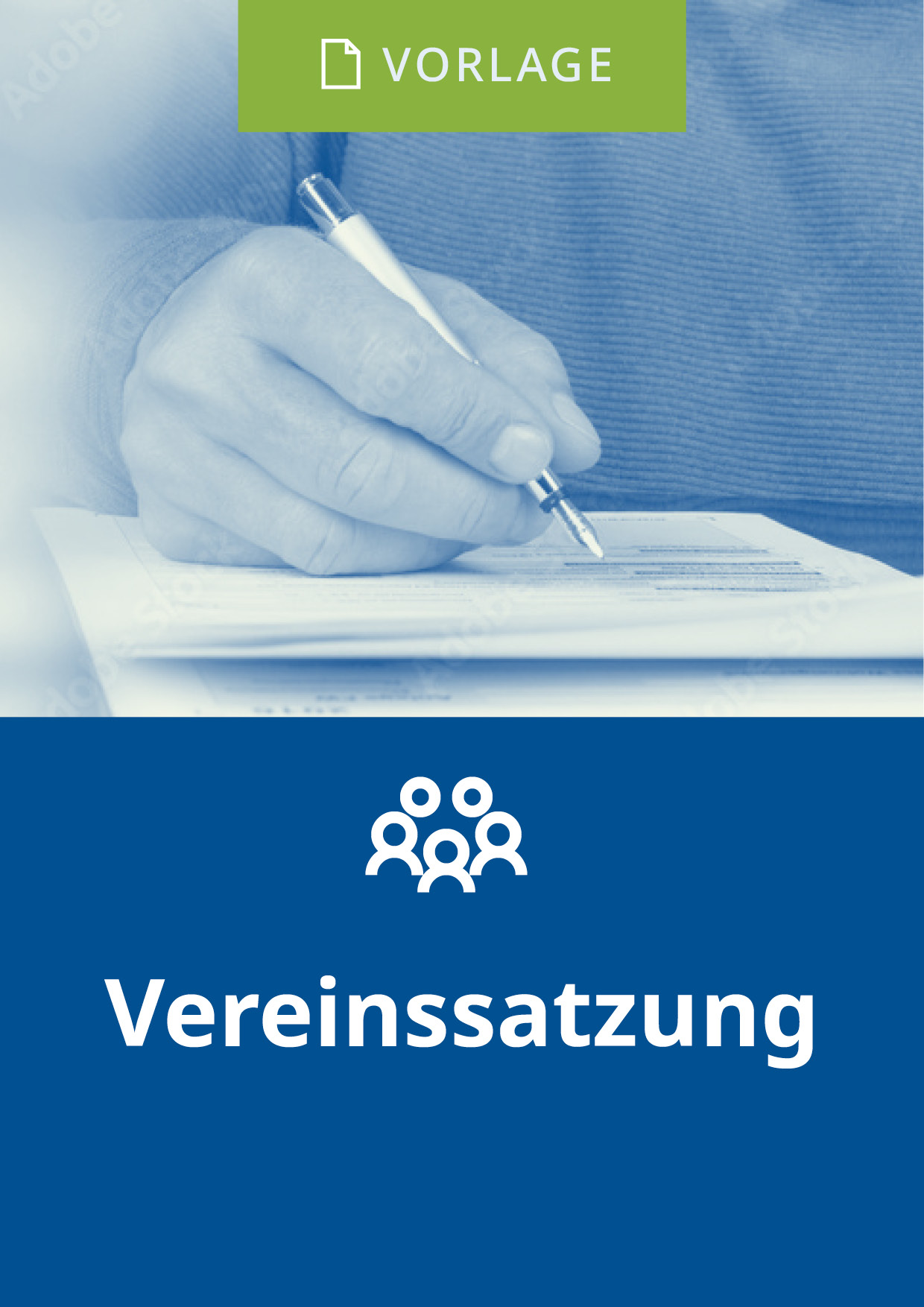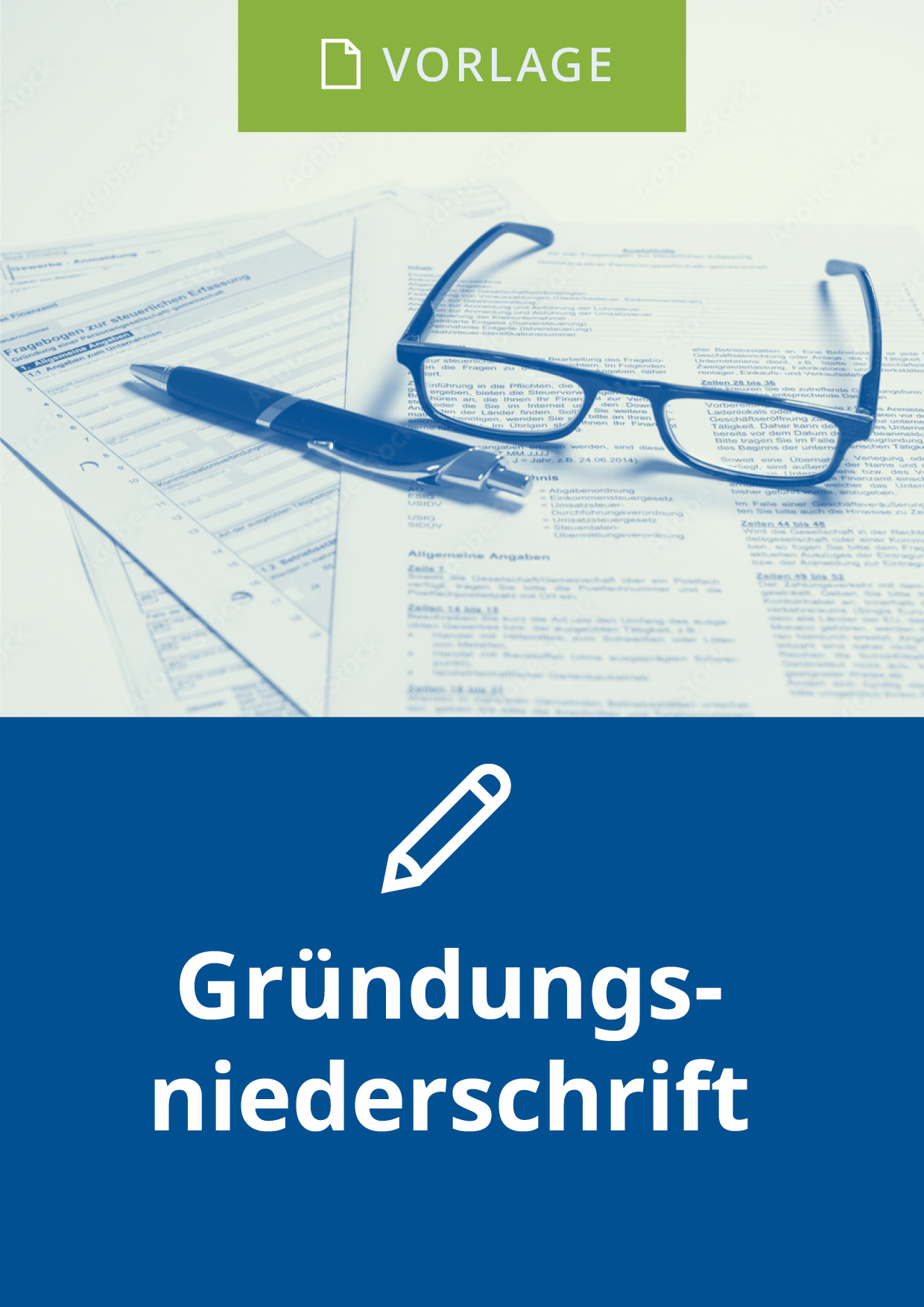Selbsthilfe-Wissen
Wir haben eine Vielzahl wichtiger Informationen zur Gründung, Leitung und Finanzierung von Selbsthilfegruppen zusammengestellt. Sie wollen ein Bankkonto für Ihre Gruppe einrichten, suchen einen Raum für Ihre Gruppentreffen oder überlegen, einen Selbsthilfeverein zu gründen? Dann finden Sie hier erste Details. Und unsere Checklisten unterstützen Sie bei Ihrer Gruppenarbeit vor Ort.
Inhalt im Überblick
Gruppengründung
Aller Anfang ist schwer. Deshalb möchten wir Sie bei den ersten Schritten zur Gründung einer Selbsthilfegruppe unterstützen. In einer Checkliste finden Sie alle wichtigen Aufgaben, die rund um die Gründung einer Selbsthilfegruppe bedacht werden sollten.
Selbsthilfekontaktstelle
Zögern Sie nicht, sich externe Hilfe zu suchen. In Deutschland gibt es dazu spezialisierte Einrichtungen, die Selbsthilfegruppen in vielfältiger Hinsicht unterstützen. Diese „Selbsthilfekontaktstellen“ finden Sie in nahezu jeder Gemeinde. Sie haben unterschiedliche Namen, beispielsweise
- Selbsthilfebüro
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen – KISS
- Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle – SEKIS
- Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich – KOBIS
Idealerweise suchen Sie den Kontakt zu einer Selbsthilfekontaktstelle in Ihrer Nähe und sprechen die Mitarbeitenden dort an! Hier haben wir eine Reihe von Themen aufgelistet, bei denen Sie dort Unterstützung erhalten können.
- Unterstützung bei Gruppengründung
- Empfehlungen zur Gruppenarbeit
- Kontaktvermittlung zu anderen Gruppen
- Hilfe bei der Raumsuche
- Rückfragen bei Schwierigkeiten in der Gruppenarbeit
- Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitarbeit
- Kontakte zu Expert*innen und Fachleuten herstellen (z. B. für Fachvorträge)
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Fortbildungen zur Arbeit in der Selbsthilfe (z. B. Gruppenleitung, Moderation, Konfliktmanagement)
- Überblick zu Fördermöglichkeiten, Unterstützung bei der Antragstellung (z. B. bei Krankenkassen)
Tipp
Nach eine Selbsthilfekontaktstelle in Ihrer Nähe können Sie hier suchen:
Ausführliche Informationen finden Sie in dem Leitfaden „Starthilfe zum Aufbau von Selbsthilfegruppen“, NAKOS 2023
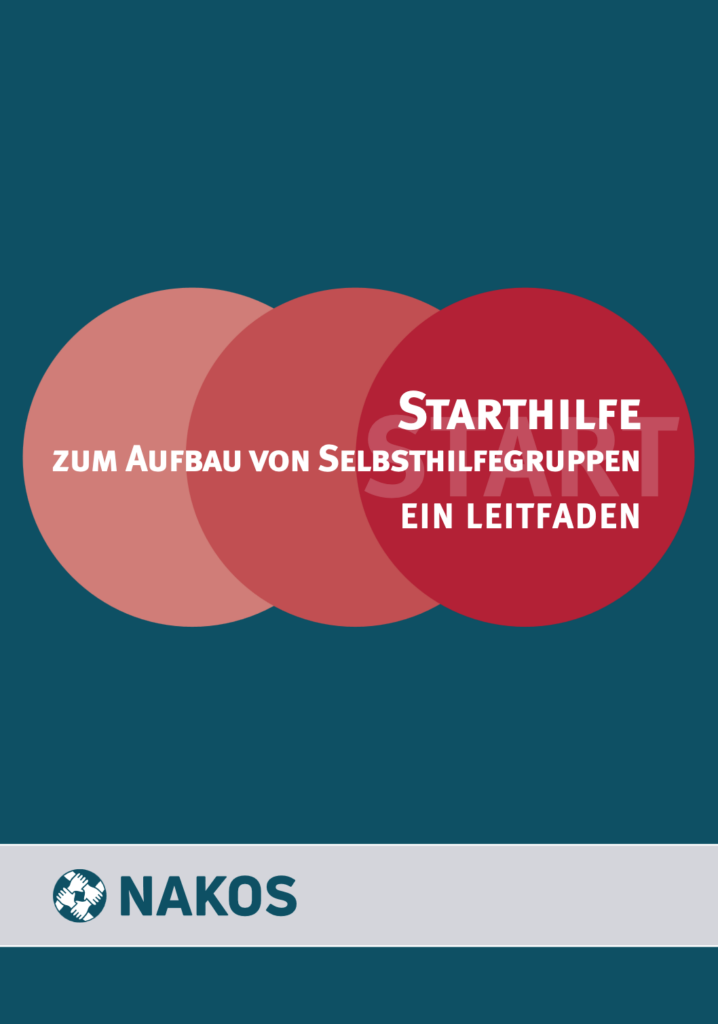
Raumsuche
Sie benötigen einen Raum für Ihre Gruppentreffen? Ein geeigneter Raum sollte nicht nur eine passende Größe haben, sondern auch für alle gut erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass die Räumlichkeit im Großen und Ganzen für die Bedürfnisse der Gruppe geeignet sind.
Tipp
Selbsthilfe-Kontaktstellen können Ihnen bei der Suche nach einem Gruppenraum helfen. Hier finden Sie einige Hinweise, wen Sie hierzu noch ansprechen können:
- Bürgerbüros, Gemeindeverwaltung
- Gesundheitsämter
- Sozial-, Jugendämter, Arbeitsagentur
- Verbände wie Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Gesundheitliche und psychosoziale Beratungsstellen
- Krankenkassen
- Schulen, Hochschulen
- Bildungsstätten wie Volkshochschulen und Kulturzentren
- Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschafts- und Stadtteilzentren
- Seniorentreffs oder Seniorenzentren
- Kirchengemeinden
- Sportvereine
Ausführliche Informationen finden Sie in dem Leitfaden „Starthilfe zum Aufbau von Selbsthilfegruppen“, NAKOS 2023
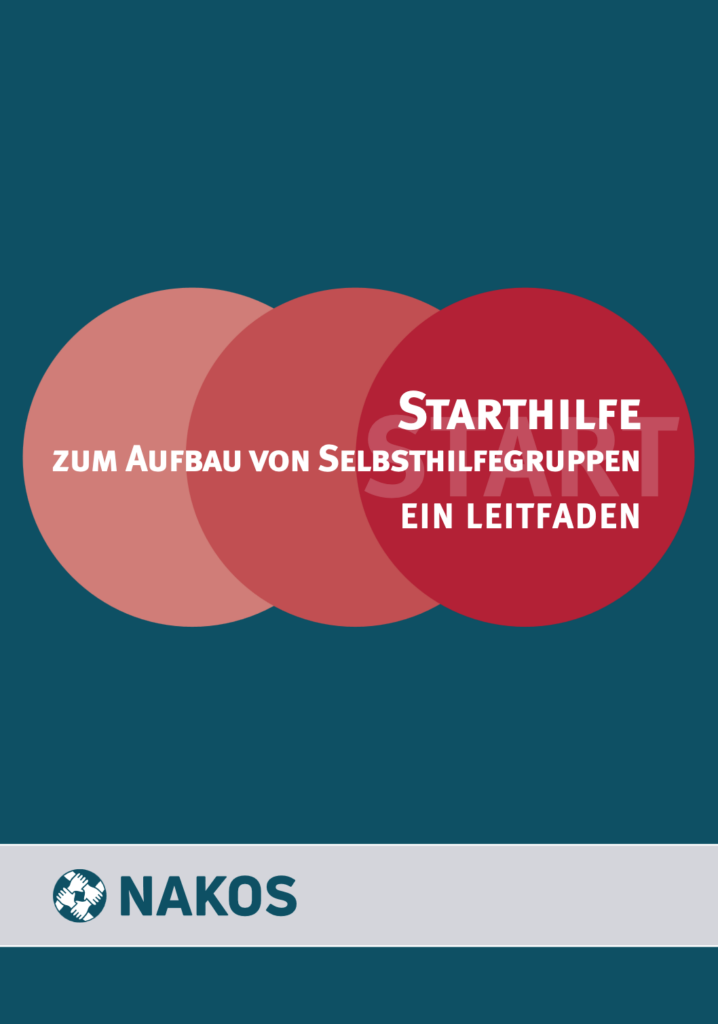
Gruppen-Name
Ein eigener Name für Ihre Gruppe fördert die Gruppenidentität und erleichtert die Öffentlichkeitsarbeit! Über geeignete Vorschläge sollte in der Selbsthilfegruppe gesprochen und abgestimmt werden. Wenn Sie den Namen Ihrer Gruppe vor Nachahmern sichern wollen, dann gibt es hierzu rechtliche Möglichkeiten:
- Die gleiche Bezeichnung darf nicht ein weiteres Mal verwendet werden, d.h. das Namensrecht einer existierenden Firma, Gruppe, Initiative oder Organisation darf nicht verletzt werden.
- Sie können den Gruppennamen beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) eintragen und damit schützen lassen.
- Auch die Namen von Internetseiten können geschützt werden.
Am besten erkundigen Sie sich in Vereinsregistern und/oder Handelsregistern, ob Namen bereits geschützt sind.
Ausführliche Informationen finden Sie in dem Leitfaden „Gemeinsam aktiv. Arbeitshilfe für Selbsthilfegruppen“, NAKOS 2023
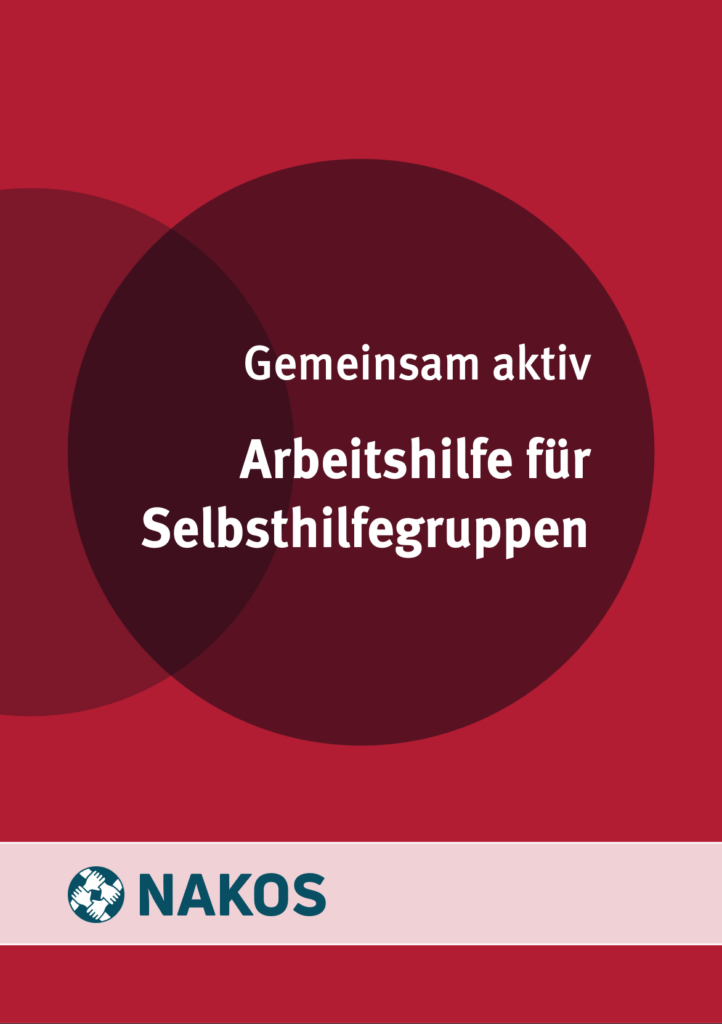
Bankkonto
Oftmals ist es nützlich, wenn die Selbsthilfegruppe über ein eigenes Bankkonto verfügt. So benötigen Sie dieses beispielsweise für die Beantragung von Fördermitteln bei den gesetzlichen Krankenkassen. Hier finden Sie einige wichtige Informationen, wie ein geeignetes Bankkonto eingerichtet werden kann:
- Ein Gruppenmitglied richtet für die Gruppe ein Treuhandkonto ein.
- Die Gruppe kann auch gemeinschaftlich als „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ ein Bankkonto einrichten.
- Sollte die Gruppe kein eigenständiges Konto bei einer Bank erhalten, akzeptieren Krankenkassen auch ein Unterkonto eines Girokontos, ein Sparkonto oder ein von einem Treuhänder eingerichtetes Konto. Selbsthilfekontaktstellen fungieren hier beispielsweise als Treuhänder.
- Unproblematisch ist die Eröffnung eines Bankkontos, wenn die Gruppe als eingetragener Verein (e.V.) organisiert ist.
Eine Bestätigung der Selbsthilfekontaktstelle kann Sie bei der Eröffnung eines Bankkontos unterstützen. Einfach die Datei herunterladen und auf dem Computer abspeichern:
(Die Mustervorlage wird durch die NAKOS mit freundlicher Genehmigung des Gesundheitstreffpunkt Mannheim e.V. bereitgestellt.)
Ausführliche Informationen zur Einrichtung eines Bankkontos finden Sie bei der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (NAKOS):
Zusammenarbeit
Die laufende Gruppenarbeit ist für viele Selbsthilfeaktive erfüllend und bereichernd. Die regelmäßigen Gruppentreffen mit anderen Betroffenen geben Ihnen die Möglichkeit, sich zur Krankheit aber auch zu familiären und beruflichen Herausforderungen auszutauschen.
Bei der Zusammenarbeit in der Gruppe ist jedoch an eine Vielzahl an Fragen zu denken. Um Ihnen die Planung und Durchführung der regelmäßigen Gruppentreffen zu erleichtern, haben wir Ihnen eine Reihe von Informationen zusammengestellt, die Sie unterstützen sollen.
Gruppenleitung
Idealerweise finden sich in Ihrer Selbsthilfegruppe eine oder zwei Mitglieder, die Verantwortung für die Leitung der Gruppe übernehmen. Für diese Personen kann eine Unterstützung im Sinne eines „Best-Practice“ sehr hilfreich sein. Dies können organisatorische Dinge sein, aber auch die Moderation der Gruppengespräche oder die Verteilung von Aufgaben. Wichtig ist auch, auf rechtliche Aspekte der Gruppenarbeit zu achten, wie beispielsweise die Beantragung von Fördermitteln oder Fragen des Datenschutzes.
Im Folgenden haben wir Ihnen eine Reihe von Informationen zusammengestellt, die Sie bei der Leitung einer Selbsthilfegruppe unterstützen sollen.
Finanzierung
Die Finanzierung von laufenden Ausgaben kann für Selbsthilfegruppen eine große Herausforderung darstellen. Sie können hierzu bei verschiedenen Trägern finanzielle Unterstützung beantragen, beispielsweise hier:
- regionales Sozial- oder Gesundheitsamt
- Bürgermeisteramt
- Landratsamt
- Geschäftsstellen von Wohlfahrtsverbänden: Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Kirchengemeinden
- Gesetzliche Krankenkassen (z. B. AOK, Techniker, BARMER, DAK, BKK, IKK u. a.)
- Stiftungen
- Sparkassen und örtliche Banken
Auf der Internetseite der BAG SELBSTHILFE finden Sie wichtigen Informationen, Materialien und Unterstützungsmaßnahmen für die Inanspruchnahme der Selbsthilfeförderung in Deutschland auf Bundes-, Landes- und Ortsebene.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auch in dem Leitfaden „Gemeinsam aktiv. Arbeitshilfe für Selbsthilfegruppen“, NAKOS 2023
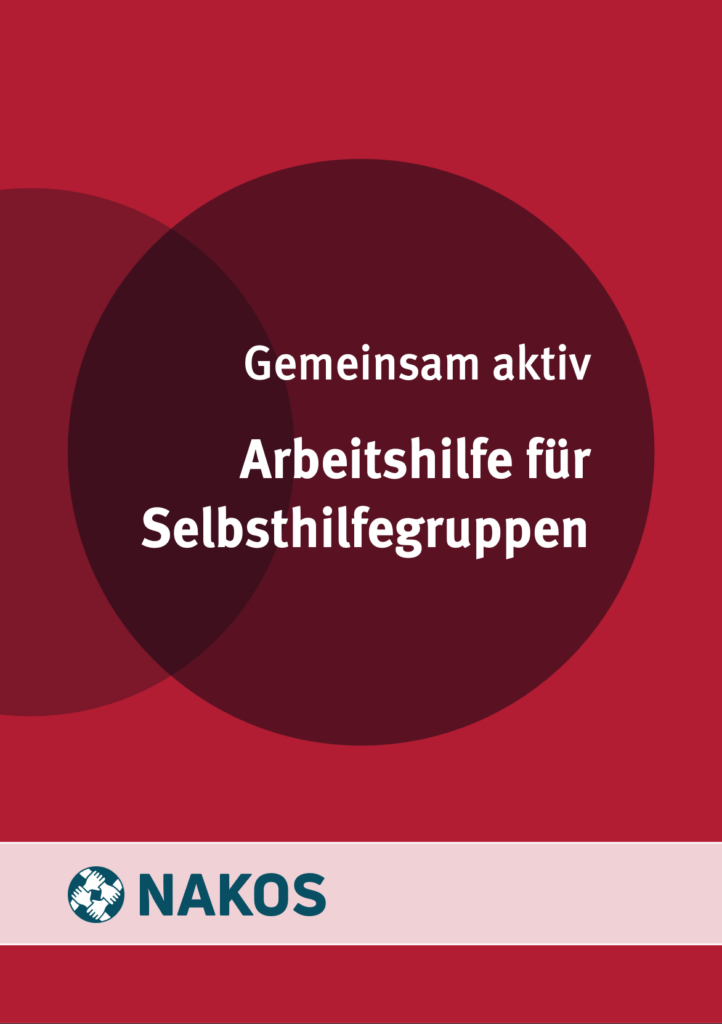
Erste Schritte
- bei der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle erkundigen
- bei anderen Einrichtungen telefonisch, per E-Mail oder persönlich Auskunft einholen
- erkundigen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen (z. B. Vereinsstatus)
- notwendige Angaben zusammenstellen
- Antragstellung genau ausführen:
- formulieren Sie sorgfältig
- fügen Sie eine Aufstellung der zu erwartenden Ausgaben bei
- machen Sie stets eine Kopie vom Antrag
Förderung durch Krankenkassen beantragen
Krankenkassen unterstützen auf vielfältige Weise die Arbeit von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich. Unterstützung erhalten Sie bei einer örtlichen Selbsthilfekontaktstelle.
Leitfaden zur Selbsthilfeförderung
Hier sind die Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes zur Förderung der Selbsthilfe beschrieben. (Hinweis: der GKV-Spitzenverband ist die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland)
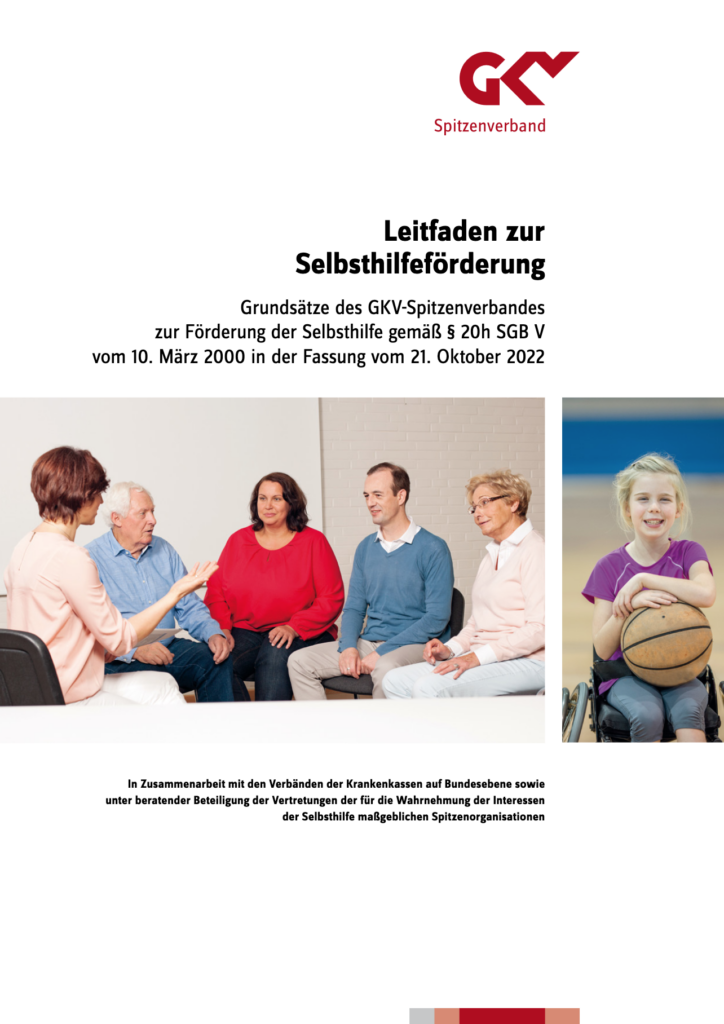
Weitere Fördermöglichkeiten
Neben der Selbsthilfeförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen bestehen auf verschiedenen Ebenen (Bundes-, Landes- oder Ortsebene) unterschiedliche Möglichkeiten zur finanziellen Förderung der Selbsthilfearbeit und -strukturen. Unter folgendem Link geben wir einen ersten Überblick mit Verlinkungen zu weiterführenden Informationen.
Rechtliche Hinweise
Sie wollen eine Selbsthilfegruppe oder eine Selbsthilfeorganisation von Long COVID-Betroffenen gründen, sind sich aber unsicher, was dabei rechtlich zu beachten ist? Es gibt in der Tat verschiedene Aspekte, die bei der Bildung einer Gruppe oder gar der Gründung eines Vereins zu beachten sind. Denn in der Regel wollen Sie dann ja auch rechtlich aktiv werden und zum Beispiel Verträge abschließen oder Klarheit darüber haben, wer im Falle eines Schadens, den ein Teilnehmender oder ein Dritter erleidet, haftet.
Wenn Personen zu einem gemeinsamen Zweck zusammenkommen, kann hiermit schnell die Bildung einer bestimmten Rechtsform verbunden sein:
- bei Selbsthilfegruppen geht man zumeist von sogenannten Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) aus
- Organisationen, die über die Größe und den Aktionsradius einer Gruppe hinausgehen, wählen in der Regel die Rechtsform des Vereins.
Tipp
Auf jeden Fall gilt: Wenn Sie zusammen mit anderen Betroffenen eine Selbsthilfegruppe bilden oder sogar die Gründung eines Vereins ins Auge fassen, sollten Sie sich vorab über die geplanten Aktivitäten und die damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen Gedanken machen!
Wir haben einige wichtige Fragen zusammengestellt, die Selbsthilfeakteuren erste rechtliche Hinweise geben!
Ist es in rechtlicher Hinsicht aufwendig, eine Selbsthilfegruppe zu gründen?
Nein. Wenn Sie sich mit anderen Betroffenen zu gemeinsamen Gruppentreffen verabreden wollen, müssen Sie hierzu keinen bestimmten rechtlichen Gründungsakt oder ähnliches vollziehen.
Bei einer Selbsthilfegruppe handelt es sich – wenn die Gruppe nicht bewusst eine andere Rechtsform wählt und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt – in der Regel um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Eine solche entsteht automatisch, auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist. Man kann und sollte natürlich von vornherein abklären, in welcher Weise die Gruppe aktiv werden will. Dann kann, wie gesagt, auch eine Rechtsform gewählt werden, für die jedoch möglicherweise bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
Kann eine Selbsthilfegruppe am Rechtsverkehr teilnehmen?
Eine Selbsthilfegruppe, die eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) darstellt, kann als sogenannte „Außengesellschaft“ Rechtsfähigkeit erlangen und somit Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie ist zwar keine „juristische Person“, dieser jedoch angenähert. Wichtig ist, dass sich die Gruppenmitglieder gut überlegen, ob und in welcher Weise sie rechtlich aktiv werden (z.B. Verträge abschließen) wollen. Denn die Erlangung einer Rechtsfähigkeit setzt zunächst einen entsprechenden gemeinsamen Willen der Gesellschafter (hier der Gruppenmitglieder) voraus. Das sollte dann auch in einer entsprechenden Vereinbarung (dem „Gesellschaftsvertrag“) hinreichend genau formuliert werden. Eine GbR kann auch eine sog. „Innengesellschaft“ bleiben, wenn sie als Gruppe keine eigenen Rechtsgeschäfte vornimmt.
Der Gesellschaftsvertrag (also eine Vereinbarung zwischen den Gruppenmitgliedern) sollte im Übrigen die Zugehörigkeit zur Gruppe regeln und die Verteilung der anfallenden Arbeit, aber auch die Verteilung etwaiger entstehender Kosten untereinander und vor allem die Frage der Vertretung nach außen.
Was ist eine juristische Person?
Neben natürlichen (also realen) Personen können auch sogenannte juristische Personen Träger von Rechten und Pflichten sein. Die Möglichkeit zur rechtlichen Selbstständigkeit von solchen Personenvereinigungen muss sich jedoch aus dem Gesetz ergeben. Im Selbsthilfebereich ist hier vor allem der eingetragene Verein als juristische Person von Bedeutung.
Was macht einen Verein aus?
Ein Verein ist eine auf Dauer angelegte Personenvereinigung, die einen gemeinsamen Zweck verfolgt und unabhängig vom Wechsel seiner Mitglieder ist. Erforderlich sind das Vorliegen einer Satzung sowie die Vereinsorgane Vorstand und Mitgliederversammlung.
Ein Verein hat zunächst keine eigene Rechtspersönlichkeit – solange er nicht im Vereinsregister eingetragen ist. Er kann jedoch trotzdem – ähnlich wie die erwähnten Gesellschaften bürgerlichen Rechts – in vielfältiger Weise am Rechtsverkehr teilnehmen. Nichtsdestotrotz beantragen viele Vereine die Eintragung in das Vereinsregister. Hierdurch erlangt der Verein eine eigene Rechtspersönlichkeit (im Sinne einer Rechtsfähigkeit) und wird als juristische Person Träger von Rechten und Pflichten.
Der Vorteil bei einem Verein besteht vor allem darin, dass eine Haftung grundsätzlich auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. Die Mitglieder haften hingegen bei Verbindlichkeiten des Vereins nicht mit ihrem Privatvermögen. Das ist nur dann der Fall, wenn dem einzelnen Mitglied bzw. dem Vorstand eine entsprechende Verantwortung und ein Verschulden trifft.
Welche rechtlichen Vorgaben bestehen für Vereine?
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält in den §§ 21 ff Regelungen, die speziell für Vereine gelten, und zwar sowohl für eingetragene als auch für nicht eingetragene Vereine. Daneben sind für gemeinnützige Vereine bzw. solche, die als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt werden wollen (das ist bei fast allen Selbsthilfeorganisationen der Fall), die entsprechenden Vorgaben nach der Abgabenordnung (AO) zu beachten. Darüber hinaus gelten natürlich alle anderen gesetzlichen Normen, soweit sie für den Verein bzw. im konkreten Fall anwendbar sind. Das können etwa die allgemeinen Haftungsregelungen des BGB sein, das kann aber auch die Datenschutz-Grundverordnung betreffen.
Neben den gesetzlichen Regelungen sind natürlich auch die vereinsinternen Vorgaben zu beachten: die Satzung, Vereinsordnungen, aber auch Beschlüsse der einzelnen Vereinsorgane.
Vereinsgründung
Auch eine Selbsthilfegruppe kann sich als Verein organisieren und eine Eintragung in das Vereinsregister beantragen. Eine Vereinsgründung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn
- man eine größere Anzahl an Teilnehmenden zählt,
- vielleicht auch Gruppentreffen über den bisherigen Ort hinaus in der Region plant,
- zusätzliche Aktivitäten neben dem Austausch in der Selbsthilfegruppe durchführen möchte,
- sich beispielsweise sozial- oder gesundheitspolitisch engagieren und auf das Vereinsthema Long COVID in der Öffentlichkeit aufmerksam machen, oder
- rechtsgeschäftlich tätig sein möchte (z.B. Verträge abschließen)
Voraussetzung für einen Wechsel hin zur Rechtsform des Vereins ist, dass es ausreichend Stimmen dafür im Kreis der Teilnehmenden gibt und genügend Personen ihre ehrenamtliche Unterstützung bei der Vereinsarbeit zusagen (insbesondere Interesse an einem Vorstandsamt zeigen).
Ist eine Vereinsgründung aufwendig?
Ein wenig Zeit sollte man für die Vorbereitung und Gründung eines Vereins sicherlich mitbringen. Dabei dürften die Formulierung der Satzung des Vereins und die formellen Voraussetzungen – wie die Durchführung einer Gründungsveranstaltung oder die Anmeldung bei Gericht, wenn man die Eintragung in das Vereinsregister anstrebt – die aufwendigsten Schritte sein.
Konkret erforderlich sind:
- die Formulierung einer Satzung
- die Einigung mindestens zweier Gründungsmitglieder, dass die Satzung für den Verein verbindlich sein und – soweit gewollt – dass der Verein ins Vereinsregister eingetragen werden soll
- die Bestellung eines Vorstandes laut Satzung
- die Protokollierung des Gründungsakts und der Vorstandsbestellung
- im Falle einer gewünschten Eintragung ins Vereinsregister: die Anmeldung bei Gericht in öffentlich beglaubigter Form (d.h. durch einen Notar) durch mindestens sieben Mitglieder
In unserer Broschüre „Rechtliche Hinweise & Vereinsgründung“ haben wir die relevanten Aspekte im Zusammenhang mit einer Vereinsgründung sowie die wesentlichen Merkmalen eines Vereins zusammengetragen. Darüber hinaus enthält es Hinweise zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).
Die Broschüre gibt Ihnen einen ersten allgemeinen Überblick – eine Reihe weiterer Literaturhinweise am Ende der Darstellung sollen Sie dabei unterstützen, die Vielzahl an rechtlichen Fragen zu vertiefen.